Vorkaufsrecht – Unserer Forderungen zur Kommunalisierung von Immobilien
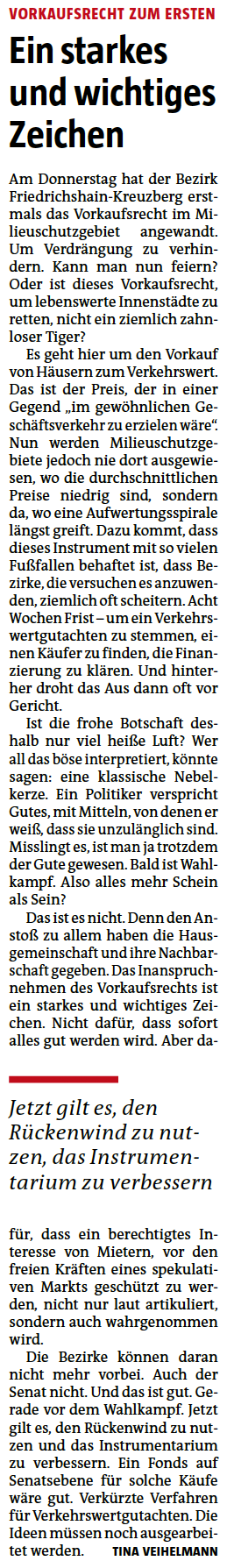 Bei Bizim Kiez gehen jetzt öfters Anfragen ein, sowohl von der Presse, wie von anderen Hausgemeinschaften, ob das Modell „Wrangelstraße 66“ auch für weitere Fälle anwendbar wäre, bei denen offensichtlich Immobilienspekulation betrieben wird. Leider muss man da skeptisch sein und im nebenstehenden taz-Artikel von Tina Veihelmann steht auch die Begründung dafür:
Bei Bizim Kiez gehen jetzt öfters Anfragen ein, sowohl von der Presse, wie von anderen Hausgemeinschaften, ob das Modell „Wrangelstraße 66“ auch für weitere Fälle anwendbar wäre, bei denen offensichtlich Immobilienspekulation betrieben wird. Leider muss man da skeptisch sein und im nebenstehenden taz-Artikel von Tina Veihelmann steht auch die Begründung dafür:
Nimmt der Bezirk das mögliche Bezirkliche Vorkaufsrecht (für Dritte) war, ist der aufzuwendende Preis der sogenannte „Verkehrswert“. Dieser wird anhand des voraussichtlich zu erzielenden Preises im Marktumfeld ermittelt. Im Falle des Hauses in der Wrangelstraße 66 sind das 3,7 Mio Euro, und dieser Preis – bzw. Wert – wurde im konkreten Fall von drei Instanzen etwa identisch eingeschätzt – vom Eigentümer, vom Bezirk und von einer Gutachterin, die von den Mieter/innen bestellt wurde. Dieser Preis spiegelt den aufgeheizten Immobilien-Markt im Wrangelkiez wider.
Der Bezirk nimmt das Vorkaufsrecht „für Dritte“ wahr und d.h. eine der Berliner Wohnungsbaugesellschaften kommt hier als zukünftige Eigentümerin ins Spiel. Im konkreten Fall soll die GeWoBAG einspringen, die aber sagt zu diesem Preis könnte sie nicht wirtschaftlich arbeiten und deshalb dürfe sie (laut Statuten des Senats) das Haus gar nicht ankaufen. Denn wenn man auf Grundlage der 3,7 Mio € eine Umrechnung auf die zu erwartenden Mieten macht, kommt man bei einer Höhe von ca. 12 €/qm raus.
Das Ergebnis wäre eine kommunale Immobilie, in der genauso hohe Mieten gezahlt werden müssten, wie wenn ein privater Investor die Immobilie „verwerten“ würde. Das Verfahren des bezirklichen Ankaufs kann also in der derzeitig möglichen Form keine Lösung sein. Es bedarf des politischen Willens des Senats (also auf der Ebene der Landespolitik), dass ein Verfahren gefunden wird, dass Mieten ermöglicht, die von den Menschen bezahlbar sind, die jetzt in den Häusern wohnen.
Ein Umdenken bei der Wohnungspolitik und eine Neukonstruktion des Bezirklichen Ankaufsrechts ist notwendig:
1. Der Zugriff des Bezirkes darf nicht auf dem Preisniveau des „Verkehrswertes“ stattfinden, sondern muss auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten berechnet werden. Darin würden u.a. der Investitionsbedarf und die Betriebskosten ermittelt, so dass anschließend eine Kostenmiete erhoben werden kann, die den Mietern eine bezahlbare Miete garantiert, und der Kommune eine Wertanlage sichert. Dies käme gegenüber dem Eigentümer natürlich auch einer gewissen Enteignung gleich, aber der Zugriff auf eine Immobilie kann ohnehin nur erfolgen, wenn unannehmbare soziale Folgen durch spekulative Geschäftspraktiken zu erwarten sind. Investoren müssten dann wirklich Verluste fürchten, wodurch sie dazu gebracht werden könnten, sogenannte „Abwendungsvereinbarung“ mit dem Bezirk abzuschließen, die den Mieter/innen garantieren, nicht verdrängt zu werden.
2. Die 2-Monatsfrist, in der das Bezirkliche Vorkaufsrecht ausgeübt werden kann, muss verlängert werden. Das Problem mit der kurzen Frist ist, dass der Bezirk so schnell kaum feststellen kann, ob ein spekulatives Geschäftsgebaren vorliegt und welche Kosten der Ankauf und der spätere Betrieb der Immobilie verursachen würden. Hier muss mehr Zeit eingeräumt werden, so dass der Bezirk und die Wohnungsbaugesellschaften handlungsfähig werden, zumindest in den Fällen, in denen Mietergemeinschaften ein Einschreiten fordern und die Sinnhaftigkeit belegen können.
3. Kommunale Wohnbaugesellschaften müssen vom Zwang der Profiterwirtschaftung entkoppelt werden. Wenn eine kommunale Gesellschaft die Vorgabe hat, mit jeder Immobilie rund 4% Rendite zu erwirtschaften, dann besteht im Geschäftsmodell kein wesentlicher Unterschied zu privaten Investoren. Momentan sind die Berliner Wohnungsbaugesellschaften als Kapitalgesellschaften dem Ziel der Profiterwirtschaftung unterstellt. Daraus folgt, dass es für Mieter/innen keinen Unterschied macht, ob sie in einer privaten oder kommunalen Immobilie wohnen, denn der ausgeübte Preisdruck – und womöglich auch Verdrängungsdruck – ist fast gleich. Wir brauchen kommunale Wohnungsbaugesellschaften indessen für die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum! Dazu muss zunächst ihre Rechtsform geändert werden und der Senat muss ihnen endlich den klaren politischen Auftrag dafür erteilen. Eine echte Kommunalisierung bedeutet, dass sie mit einem politischen und sozialen Auftrag versehen und demokratisch vom Parlament und von Mieterselbstverwaltungsstrukturen kontrolliert werden.
4. Es muss ein Fonds zur Kommunalisierung von Immobilien geschaffen werden. Das Dilemma wird im konkreten Fall der Wrangelstraße 66 sehr deutlich und es hängt mit Punkt 1, dem „Verkehrswert“, zusammen. Der Bezirk hat dem Eigentümer des Hauses mitgeteilt, dass er das Vorkaufsrecht ausüben wird. Natürlich will und kann aber der Bezirk die 3,7 Mio nicht selbst aufbringen, sondern möchte eine Wohnungsbaugesellschaft dazu bringen, das Haus zu übernehmen. Es braucht deshalb einen Fonds auf Landesebene, mit dem der Zugriff auf die Immobilien tatsächlich realisiert werden kann.
